Bergbau in Sulzbach-Rosenberg
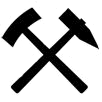
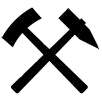 Ehemaliger Maxhütten-Arbeitsdirektor Manfred Leiss
Ehemaliger Maxhütten-Arbeitsdirektor Manfred Leiss"Bergbau, Maxhütte, Sozialgeschichte"
Die Oberpfalz als wichtiger Eisenproduzent im Mittelalter
(dazu auch Bericht Nr.1 des Geschichtsausschusses des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute, 1950)
In
der Wirtschaft der mittelalterlichen Oberpfalz spielte die
Eisenindustrie eine Hauptrolle. Abbauwürdige Eisenerzlager sind in der
Oberpfalz an vielen Orten vorhanden, die bedeutendsten
um
Amberg, Sulzbach und Auerbach bis zu einem Eisengehalt von 52 %. Die
Erze im weiteren Umfeld wiesen 20-28 % Fe auf. Der Erzbergbau um Kelheim
reicht bis in die vorchristliche Zeit zurück, die dort aufgefundenen
Spuren deuten darauf hin, dass die Kelten schon Eisen gewonnen haben.
Geschichtsschreiber schlossen nicht aus, dass Karl der Große 787 den
Ambergern am Erzberge Rechte verliehen habe und von ihm stamme auch der
Plan, Donau und Main durch einen Kanal miteinander zu verbinden. Im
oberpfälzischen Eisenbergbau des Mittelalters kannte man sowohl den
Tagebau als auch den Tiefbau. Die landesherrlichen Berglehensbriefe
schrieben genau vor, bis zu welcher Tiefe man im Wasser „würken“ dürfe
und es wurden bis zu 50“Claffter“ Tiefe genannt ( 1 Claffter entsprach
etwa 2 m). Den Beschreibungen nach umriss das“Würken“ in den Gruben um
Amberg und Sulzbach auch einen Zeitraum von 4-6 Jahren Abbau, weil
angeblich nur so viel gefördert wurde, wie man absetzen konnte, während
kleine Gruben durchgehend betrieben wurden.
Im Jahre 1596
wurde in 11 Amberg/Sulzbacher Gruben 899 Pfund Bergfuder Erze als
Jahresleistung gefördert, umgerechnet 2.429.000 Zentner oder 121.000
Tonnen. Diese Fördermengen kann sonst kein Eisenerzbergwerk in
Deutschland nachweisen. Die Förderleistung eines Bergknappen je Schicht
betrug 11,2 Zentner; die Kosten am Berg erreichten 88 088 Gulden und für
den Wert der geförderten Erze sind 118 000 Gulden notiert.
Bei
dem enormen Holzbedarf der Hütten und Bergwerke mussten Wege für eine
geregelte Waldwirtschaft gefunden werden. Es sind auch entsprechende
Waldordnungen überliefert, trotzdem blieb Raubbau vielerorts nicht aus.
Genau so wichtig für die Eisenindustrie war die Nutzbarmachung der
Wasserkraft. 1270 sind die ersten Eisenhämmer der Oberpfalz urkundlich
erwähnt und Anhaltspunkte für die Nutzung der Wasserkraft im Hüttenwesen
ergeben sich aus den Ortsnamen wie Schmiedmühlen oder der Namen meist
adeliger Betreiber. Um das Wasser der Flüsse und Bäche nutzen zu können,
wurden Querdämme zum Stauen errichtet und das Wasser an die Räder der
Hammerwerke geleitet oder künstliche Stauanlagen(Hammerweiher) angelegt.
Die Oberpfälzer Hammerwerke waren entweder Eisen erzeugende oder Eisen
verarbeitende Anlagen, erstere Schien- und Stahlhämmer und letztere
Blech-, Draht-, Zain-, Streck- und Kugelhämmer sowie Waffenhämmer.
Die bei Ausgrabungen 2013
in Amberg entdeckten Spuren deuten mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auf den Betrieb eines Rennfeuerofens aus der Zeit
zwischen 1258 und 1270 hin und mit seiner denkbaren Beschaffenheit kann
er bereits als eine Vorstufe hin zum Stückofen und als Vorgänger des
späteren Hochofens gelten.
Im Dienste der Eisenindustrie
standen nicht nur die Berg- und Hüttenleute sowie die Eisenhändler. Man
brauchte auch Holzfäller, Köhler, Fuhrleute und Schiffer. Viele Gewerbe
lebten damals von der Eisenindustrie. Um die Erze von den Förderorten zu
den Hämmern zu fahren, standen viele Bauern im Dienst der
Eisenindustrie, die ihre Felder einfach liegen ließen. Das rief den Zorn
der Landesherren hervor und sie ordneten an, dass Erz-
Eisen-Kohlefuhren nur noch in der Winterzeit gemacht werden durften.
Neben dem Landweg war die Vils seit dem 11.Jahrhundert als Transportweg
wichtig.
Kaiser Ludwig der Bayer, der erste Wittelsbacher auf dem Kaiserthron, trat durch den Hausvertrag von 1329
den größten Teil des bis dahin als „Bayerischer Nordgau“ bekannten
Gebietes seinen Neffen, den Pfalzgrafen bei Rhein ab. Diese gaben ihrem
neuen Besitztum zur Unterscheidung von ihren bisherigen Ländern den
Namen Ober-Pfalz, überließen ihr aber eine gewisse Selbständigkeit, mit
Statthalter, der nach Heidelberg berichten musste. Ludwig VI .aus einem
kleinen Herzogtum in Niederbayern stammend, war durch seinen Sieg über
die Habsburger in der Schlacht von Gammelsdorf (1313) legendär geworden
und den Ruf konnte er in der letzten Ritterschlacht ohne Feuerwaffen
1314 bei Mühldorf gegen die Habsburger festigen.
Der
exkommunizierte Ludwig setzte in seiner Konfrontation mit dem
machtbewußten, in Avignon regierenden Papst, auf arme Orden wie
Minoriten und Franziskaner, die „Occupy- Bewegungen des
14.Jahrhunderts“. Ludwig VI. steht für die Einigung Bayerns und die
Ausdehnung der Wittelsbacher Macht bis nach Tirol, Holland und
Brandenburg.
Reiche Eisenlager wurden über- und untertage
abgebaut und Eisen in beachtlicher Menge gewonnen, sodass die Oberpfalz
für gewöhnliches Schmiedeeisen der wichtigste Produzent in Europa wurde.
Die oberpfälzischen Blechhämmer stellten vor allem Fein- und
Bodenbleche her. Die Bleche waren genormt. Diese kamen als Schwarzbleche
in den Handel oder wurden verzinnt und als Weißbleche verkauft. Das
Verzinnen der Bleche ist eine Erfindung im bayerischen Nordgau,
begünstigt durch die Blecherzeugung der Oberpfalz und die Zinnvorkommen
des Fichtelgebirges und datiert von 1300. Ortschaften mit dem Namen
Plech (im Jahre 1118 genannt), dürften von daher kommen. Die
Zinnblechindustrie war in Nürnberg, Wunsiedel und später in Amberg stark
vertreten und auch zu Sulzbach verzinnte man Bleche.
Die Bergstädte Amberg und Sulzbach
Die
Bergstädte Amberg und Sulzbach übten ihren bestimmenden Einfluss in der
Oberpfalz durch die 1341 geschlossene Hammereinigung aus, die bis 1650
regelmäßig erneuert wurde. Eine 1655 von Amberg vorgeschlagene Hammereinigung
wurde vom Sulzbacher Herzog abgelehnt, da er seinen Hochofen bei
Fichtelberg nicht in die Einigung einbeziehen wollte. Auch die in der
Region vorzufindenden Unternehmensformen bedienten sich kapitalistischer
Arbeitsweise; die in Regie der Stadt Amberg agierende Gesellschaft warf
eine jährliche Dividende von 8 % aus.
Amberg als „süddeutsche
Eisenstadt“ dominierte auch den Handel und überließ Sulzbach nur den
zweiten Platz. Die vorherrschende Stellung verdankte Amberg seiner Lage
am Erzberg und an der Vils als wichtigen Wasser- und Transportweg.
Kaiser Barbarossa hatte den Ambergern schon 1163 Zollfreiheit durch das
ganz römische Reich Deutscher Nation verliehen und auch der Bischof von
Passau räumte Amberg weitgehende Transportrechte ab der Donau bis nach
Ulm ein.
1356 hatte Kaiser Karl IV
in der goldenen Bulle das Bergregal den Landesfürsten übertragen, die
somit über die Bodenschätze verfügen konnten. Die Landesherren als
Besitzer der Gruben verliehen Berglehen an die Gewerken; diese mussten
dafür an die Landesherren den Bergzehnten entrichten, ursprünglich den
10.Kübel; seit dem Jahre 1450 den 17.Kübel. Dazu kam der Bergzoll nach
dem für jedes abgefahrene Fuder Erz der Käufer einen Geldbetrag zu
zahlen hatte, also eine Art Umsatzsteuer.
Die Rechte und
Pflichten der Bergknappen waren in den Bergordnungen geregelt, die der
Hammergewerken und ihrer Arbeiter in den landesherrlichen Hammerbriefen.
Die Hammerzinsen betrugen im 14.Jahrhundert 12 rheinische Gulden,
später 16-24 Gulden. Die Hammermeister übten für einfache Vergehen auch
die Gerichtsbarkeit aus. In der Feinblecherzeugung und hier insbesondere
für die Herstellung verzinnter Bleche besaß die Oberpfalz Jahrhunderte
lang das europäische Monopol.
Ende des 16.Jahrhunderts
beschäftigte der oberpfälzische Eisenerzbergbau 1000 Bergleute. Der
erste oberpfälzische Hochofen in Pielenhofen/Naab in 1505,-dem Typ nach
ein Blasofen/Stuckofen- geht auf die Pfalzgrafen von Neuburg Sulzbach
zurück und 1602 wurden im Fichtelgebirge Hochöfen nach Siegener Bauart
errichtet.
Auf Schien- und Stabhämmern sowie Blechhämmern
wurde das gewonnene Eisen verarbeitet. Im Jahre 1387arbeiteten in der
Oberpfalz 125 Schienhämmer und 22 Blechhämmer; 1545 waren 119
Schienhämmer und 82 Blechhämmer in Betrieb. Das Geschäft mit verzinnten
Blechen florierte und führte 1533 zur Gründung der „Amberger Zinnblechhandelsgesellschaft“,
die infolge Überschuldung 1631 aufgeben musste; die
Nachfolgegesellschaft war mit ihren Produktionskosten ebenfalls nicht
wettbewerbsfähig und scheiterte auch wegen der Entlassung von
Fachkräften protestantischen Glaubens, die nach Sachsen ausgewandert
waren.
Der Dreißig jährige Krieg war für die Oberpfalz
verheerend und verwüstete Bergbau und Eisenindustrie. Die besonders von
1633-1634 grassierende Pest raffte ein Drittel der Bevölkerung hinweg.
Nach dem Aderlass des langen Krieges und den Religionsstreitigkeiten war
eine Verarmung und Verödung eingetreten, die wirtschaftliche
Initiativen unterband. Die Landesherren verkündeten deshalb 1690 einen
Erlass zur Belebung des Bergbaus und erteilten ab 1691 Schürffreiheit.
Bleibt
festzustellen, dass die Eisenindustrie der Oberpfalz im Mittelalter ein
Wirtschaftsfaktor ersten Ranges war. 1475 sollen 12.000 Menschen
unmittelbar von dieser abhängig gewesen sein und indirekt 25 % der
Wohnbevölkerung. Insoweit ist die vergleichende Bezeichnung „Ruhrgebiet
des Mittelalters“ eine angemessene.
© Manfred Leiss
