Bergbau in Sulzbach-Rosenberg
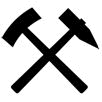
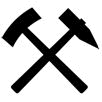
Helmut Heinl Autorenseite
"Leben in der Bergmannssiedlung"
Als die Kohlenmeiler rauchten
Über das vergessener Köhlerhandwerk
Die Oberpfalz wird häufig als das „Ruhrgebiet des Mittelalters" bezeichnet. Urkunden, vor allem aber archäologische Grabungen[i] beweisen, dass sich unsere Heimat bis zum Dreißigjährigen Krieg durchaus zu den bedeutenden Wirtschaftsräumen des Heiligen Römischen Reiches zählen lässt. Man denkt an rauchende Hochöfen, Bergleute unter Tage und lärmende Hammerwerke.
Was heute in der Vorstellung so gut wie nie vorkommt, ist der Rauch der Kohlenmeiler, der geräuschlos über die Wälder des Reviers zog, wo die zur Verhütung des Eisenerzes wichtige Holzkohle gewonnen wurde. Dabei hätte ohne Holzkohle kein Erz geschmolzen werden und kein Hammerwerk schmieden können. Deshalb ist die Köhlerei mindestens so alt wie die Metallverarbeitung. Die ersten schriftlichen Quellen über Köhler und die Köhlerei stammen aus der vorrömischen Eisenzeit. Theophrast (371-287 v. Chr.) beschrieb den Verkohlungsprozess, und im ersten Jahrhundert nach Christus dokumentierte Plinius der Ältere (ca. 23-79 n. Chr.) die Verkohlung in stehenden Meilern. Dabei wird die Verkohlungs- oder Nutzungsqualität vieler Hölzer genau beschrieben. Das zeigt, die Römer hatten damals schon eine lange Erfahrung mit dieser Technik.[ii] In China wurde Holzkohle bereits ca. 1600-1046 v. Chr. zur Metallverarbeitung verwendet.So wurde Kohle schon in der Bronzezeit verwendet, denn auch dazu war eine Temperatur von 900 bis 930° notwendig, die sich nur mit Holzkohle erzielen ließ. Das war nur durch die viel höhere Energiedichte als beim Holz möglich. Deshalb war Holzkohle einige Jahrtausende lang der wichtigste Brennstoff für Schmiede, Bronze- und Eisenverhüttung und andere metallverarbeitende Betriebe. Schon vorher wurde sie vermutlich bereits für Rauchopfer oder gar medizinische Zwecke eingesetzt.
Erzeuger dieses Rohstoffes waren von jeher die Köhler. Sie betrieben ihr Handwerk logischerweise in Wäldern, wo sie Holz sammelten und in Meilern verkohlten. Ein Meiler war ein systematisch geschichteter Haufen von Holzscheiten, der mit Erde und Grassoden so abgedeckt wurde, damit der Luftzutritt kontrolliert werden konnte.[iii]
Mit zunehmender Verarbeitung von Eisenerz zu Werkzeugen und Waffen, im Mittelalter, wurde die Kohle nicht nur regional verwendet, sondern zu einem begehrten Handelsgut. Der Bedarf war enorm.
Holz ist ein Naturprodukt. Der Heizwert der daraus gewonnenen Kohle hängt auch von der Holzart ab. Deswegen lassen sich zum Kohleverbrauch nur ungefähre Angaben machen. Dr. Martin Straßburger[iv] macht dazu (zusammengefasst) folgende Angaben. „Um 1 t Holzkohle herzustellen wurden etwa 7-8 t Holz benötigt. Im zwölften Jahrhundert wurden für die Produktion von 300 kg Eisen 12 m³ Holzkohle benötigt.“ Wer mit Holzkohle grillt, merkt, wie leicht das Material ist und warum man so viel Kohle bzw. Holz braucht, um Eisen zu schmelzen.Es ist bekannt, welche Auswirkungen die Köhlerei auf die Wälder hatte.[v]
Die einst dichten Urwälder der Oberpfalz wurden durch die boomende Eisenindustrie im Mittelalter stark ausgedünnt, so stark, dass die Herrschenden begannen, die Nutzung der Wälder durch Vorschriften zu regulieren. Denn Holz wurde damals ja nicht nur verkohlt – man brauchte es überall: Bauholz, Brennstoff zur Heizung, Möbelholz, Kunsthandwerk.Bevor im späten 19. Jahrhundert die Steinkohle mit der Eisenbahn und mit Fuhrwerken in die entlegensten Gebiete vordrang, war die Köhlerei ein Gewerbe, das überall anzutreffen war, wo ausreichend Holz zur Verfügung stand. Denn die Schmelzöfen, die Hammerwerke und Glashütten in der Oberpfalz benötigten riesige Mengen davon, möglichst nahe am Verarbeitungsort. In den Bergbaugebieten kam das Grubenholz hinzu. Darüber hinaus war es über Jahrhunderte üblich, Vieh in den Wäldern weiden zu lassen und anfallende Streu oder Laub zu sammeln und in den Ställen als Unterstreu zu verwenden.
Die Köhlerei wurde nicht immer als professionelles Handwerk betrieben. Oft waren die Köhler kleine Bauern, die Produkt im Nebenerwerb erzeugten. Vor allem im Winter, wenn keine Felder bestellt werden mussten, versuchten sie mit der Köhlerei ihren Lebensunterhalt zu verbessern.
Da die Holzverkohlung nur im Wald möglich war, und der Meiler ständig kontrolliert werden musste, bedeutete dies oft eine lange Abwesenheit vom häuslichen Herd. Um sich vor Nässe und Kälte zu schützen, bauten sich die Männer meistens direkt am Meiler einen Unterstand. Köhler galten als Einzelgänger. Sie brauchten keine feste Behausung, sondern nur eine primitive Schutzhütte. Man stellte kieferne oder fichtene Stangen dicht aneinanderreiht, mit den Spitzen aufragend, kegelförmig zusammen. Heidekraut und Rasenstücke dichteten dann den Bau und machten das Innere wetterfest. Fenster hatte die Köhlerhütte nicht. Das Licht drang durch den Eingang ins Innere. Dort war ein kleiner Überbau, als Regenschutz, mit einer schräg gestellten, roh gezimmerten Holztüre.Es bedarf keiner Erläuterung, dass die hygienischen und gesundheitlichen Umstände äußerst ungünstig waren. Besonders längere Regenperioden oder kalte Winter schadeten den „Bewohnern“ ebenso wie die schwere Arbeit beim Aufschichten der Meiler. Dieses „Hausen“ in primitivsten „Schutzhütten“ und ihr rußiges Aussehen trugen zum niedrigen sozialen Ansehen der Köhler bei. Das hat sich bis zum Verschwinden der Köhlerei nicht geändert. Als fern von den Gemeinschaften der Menschen, im Wald lebende Männer, waren sie ihren Zeitgenossen nicht immer ganz geheuer, zu mindestens nach vielen Märchenüberlieferungen.
Im Wesentlichen mit der Entdeckung der Steinkohle und der später daraus erzeugten Koks-Kohle entstand ein völlig neues Brennmaterial für die Eisenerzeugung. Es war in großen Mengen vorhanden und konnte bergmännisch abgebaut werden.
In unmittelbarem Zusammenhang steht auch die Entwicklung der Wärmekraftmaschine (Dampfmaschine), die ihren technischen Höhepunkt in der Eisenbahn erreichte. Mit Dampfkraft war es möglich Steinkohle leichter abzubauen und ebenso wie den Steinkohlenkoks in Deutschland zu transportieren. Holzkohle war innerhalb weniger Jahrzehnte für die industrielle Nutzung bedeutungslos geworden.
Obwohl ihre Arbeit für die industrielle Metallerzeugung und- Bearbeitung genauso wichtig war, wie die der Bergleute und Schmelzer hatten sie einen ganz anderen sozialen Status. Obwohl sie eigentlich Handwerker waren, hatten sie keine eigenen Zünfte oder eine Standesorganisation wie die Knappschaften der Bergleute.
Bergleute vs. Köhler
Bergleute hingegen hatten schon im Mittelalter ein höheres soziales Ansehen. Der Bergbau war eine zentrale Industrie, die nicht nur für die Gewinnung von Metallen, sondern auch für die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen von Bedeutung war. Er erforderte ein Zusammenwirken verschiedener Wissensbereiche. Angefangen von Rutengängern, über den Markscheider bis hin zu den Hauern und Schleppern. Alle brauchten eine gewisse Ausbildung, um die Bodenschätze unter Tage ausbeuten zu können. Ihr Arbeitsleben musste organisiert sein, weil verschiedene Bereiche zusammenarbeiteten. Die einen lösten das Erz aus dem Gestein. Die anderen sorgten für den Ausbau der Stollen, schöpften das Grubenwasser, und wieder andere sortierten und verkleinerten das Erz.
Die Bergleute hatten den Vorteil, dass ihre Erzeugnisse die Bergwerksbetreiber und Landesherren reich machten. Das bedeutete für Letztere auch Macht. Deswegen gewährten ihnen die Landesherren gewisse Freiheiten und Rechte. Teilweise genossen sie die direkte Unterstützung ihrer Fürsten. Im Erzgebirge gab der Landesherr die Form der Bergmannstracht vor, veranlasste Bergparaden und hob damit den Bergmannsstand.
So ausgeprägt war die Förderung in der Oberpfalz nicht. Aber man war sich sehr wohl bewusst, dass das Erz Geld in die Stadtsäckel brachte. Städte wie Amberg und Sulzbach konnten sich ihre Bauten und Kirchen nur leisten, weil der Bergbau Arbeit und Abgaben lieferte – und weil die Bergwerkseigentümer oder Anteilseigner durch Stiftungen etwas für ihr Seelenheil tun wollten.
Wegen der Gesundheit für Leib und Leben unter Tage schufen sich die Bergleute sehr früh Unterstützungskassen (Bruderkassen) und Standesorganisationen, wie die Knappschaftsvereine. Schon damit waren ihr Umfeld und die Lebensbedingungen deutlich besser als die der Köhler.
Was ist von diesem Handwerk geblieben?
Die Kohlenmeiler brannten früher in der Oberpfalz überall. Mathias Hentsch a. a. O. spricht von „Tausenden“. Heute sind sie längst verschwunden. Einst zogen fast ununterbrochen Schwaden von grau-weißlichem Rauch langsam durch die noch vorhandenen Wälder des Amberg-Sulzbacher Landes. Ähnlich sieht man es heute noch, wenn Bauern beim Holzfällen die Streu verbrennen. Die Spuren dieses uralten Handwerks allerdings sind noch viel seltener zu finden als jene der Bergleute. Wer sie sucht, braucht entweder einen ortskundigen Führer oder muss sich an alten Flurbezeichnungen orientieren.
Im Peutental, an der nordwestlichen Stadtgrenze von Sulzbach, sind sie noch zu verorten. Dort gibt es eine Flurbezeichnung „Mailerstätte“.[vi] In der Reliefkarte des Bayernatlas sind die Vertiefungen der Meiler noch sehr deutlich erkennbar. Nach Aussage des Bauern Konrad Pirkel aus Gassenhof gibt es dort viele Meilerplätze und beim Graben findet man an diesen Stellen Kohlenreste und verbrannte Erde im Boden.[vii] Zwischen Siebeneichen und Ammerthal, in der Nähe der „großen Douglasie“ gibt es die Flurbezeichnung „Meillerseige“[viii] Man kann aber auch in alten Flurkarten bei der Flurbezeichnung „Meilleracker, Meilerwiese“ fündig werden.
Trotz der einstigen Bedeutung dieses Berufszweiges aber waren die Köhler bis vor einigen Jahren so gut wie völlig vergessen.
Wie kam es zu dem völligen Verschwinden der jahrtausendealten Tradition?Im Wesentlichen mit der Entdeckung der Steinkohle und der später daraus erzeugten Koks-Kohle entstand ein völlig neues Brennmaterial für die Eisenerzeugung. Es war in großen Mengen vorhanden und konnte bergmännisch abgebaut werden.
In unmittelbarem Zusammenhang steht auch die Entwicklung der Wärmekraftmaschine (Dampfmaschine), die ihren technischen Höhepunkt in der Eisenbahn erreichte. Mit Dampfkraft war es möglich Steinkohle leichter abzubauen und ebenso wie den Steinkohlenkoks in Deutschland zu transportieren. Holzkohle war innerhalb weniger Jahrzehnte für die industrielle Nutzung bedeutungslos geworden.
Die sozialen Auswirkungen des Rückgangs der Köhlerei nach dem Aufkommen von Stein- und Braunkohle waren vielfältig und tief greifend:
1. Verlust von Arbeitsplätzen: Viele Köhler verloren ihre Arbeit, da die Nachfrage nach Holzkohle stark zurückging. Dies führte zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten für viele Familien, die von der Köhlerei abhängig waren.
2. Berufswechsel und Migration: Viele ehemalige Köhler mussten sich neue Einkommensquellen suchen. Einige wanderten in Städte ab, um in Fabriken oder im Bergbau zu arbeiten.
3. Verlust von Wissen und Tradition: Mit dem Rückgang der Köhlerei ging auch viel traditionelles Wissen verloren. Die Techniken und das Handwerk wurden nicht mehr weitergegeben. Meilerplätze verschwanden.
4. Soziale Stellung: Die soziale Stellung der Köhler, die ohnehin oft als einfache Arbeiter betrachtet wurden, verschlechterte sich weiter. Im Gegensatz zu Bergleuten und Schmelzern oder Schmieden, verschwand ihr Handwerk völlig aus dem öffentlichen Bewusstsein.
5. Diese sozialen Auswirkungen zeigen, wie tief greifend der Wandel war, den die Köhlerei durchlief, während sich bei Bergleuten und Schmelzern nichts änderte.
Durch den Kohlenmangel im Zweiten Weltkrieg flackerte die Köhlerei noch einmal kurz auf, ohne jedoch jemals die frühere Bedeutung zu erlangen.
Erhalt der Tradition: Nur in wenigen Regionen wurde die Köhlerei als kulturelles Erbe bewahrt. Inzwischen haben sich Interessensgemeinschaften der Köhler gebildet, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die uralte Tradition wieder aufleben zu lassen und so die „rußigen Gesellen“ im kollektiven Gedächtnis zu erhalten. Mit ihnen sollen das Wissen und die Techniken der Köhlerei im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen und Tourismus weitergegeben werden.
Ein Beispiel dafür sind die Köhlerfreunde Ebermannsdorf[ix]. Sie sind eine der wenigen Organisationen in der Oberpfalz, die sich um das Erbe der Köhler kümmern und durch viele Veranstaltungen die Erinnerung an diese früher überall vorhandene Handwerkergruppe erinnern.
© Helmut Heinl 2025
[i] Hentsch Mathias “ in „Köhler. Schmelzer. Schmiede“; Eisen in Ostbayern von den Kelten bis ins frühe Mittelalter. Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums Ostbayern; S. 139 ff.
[ii] https://www.europkoehler.com/geschichte_der_koehlerei.cfm
[iii] https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/K%C3%B6hler
[iv] Straßburger Martin „Eisenproduktion und Köhlerei von der Latenzzeit bis ins frühe Mittelalter“ in „Köhler. Schmelzer. Schmiede; Eisen in Ostbayern von den Kelten bis ins frühe Mittelalter; S. 15 ff
[v] https://www.mittelalter-lexikon.de/wiki/K%C3%B6hler
[vi] https://atlas.bayern.de/?c=695004,5491760&z=16&r=0&l=historisch&t=ba
[vii] Hentsch Mathias „Erz-Feuer-Eisen“. Eine kleine Geschichte des früheren Montanwesens in der mittleren Oberpfalz S. 43. Er schreibt „Frühe Meiler Plätze muss es im Raum Amberg Sulzbach-Auerbach also zuTausenden gegeben haben.
[viii] Quelle: Mitteilung von Revierförster Daschner
[ix] www.köhler-ebermannsdorf.de Ein Verein, der sich intensiv mit der Traditionspflege der Köhlerei befasst. Siehe: https://www.onetz.de/themen/koehlerfreunde-ebermannsdorf
